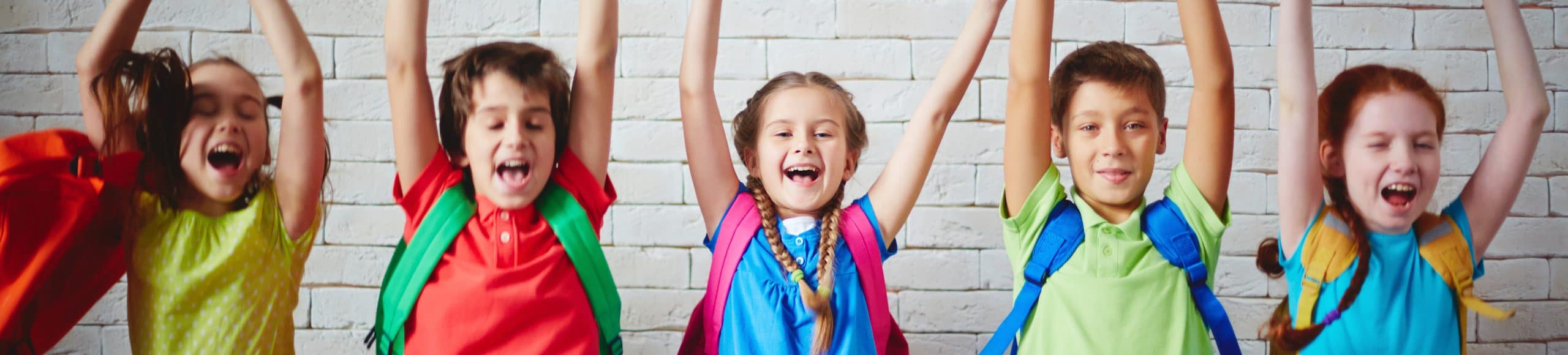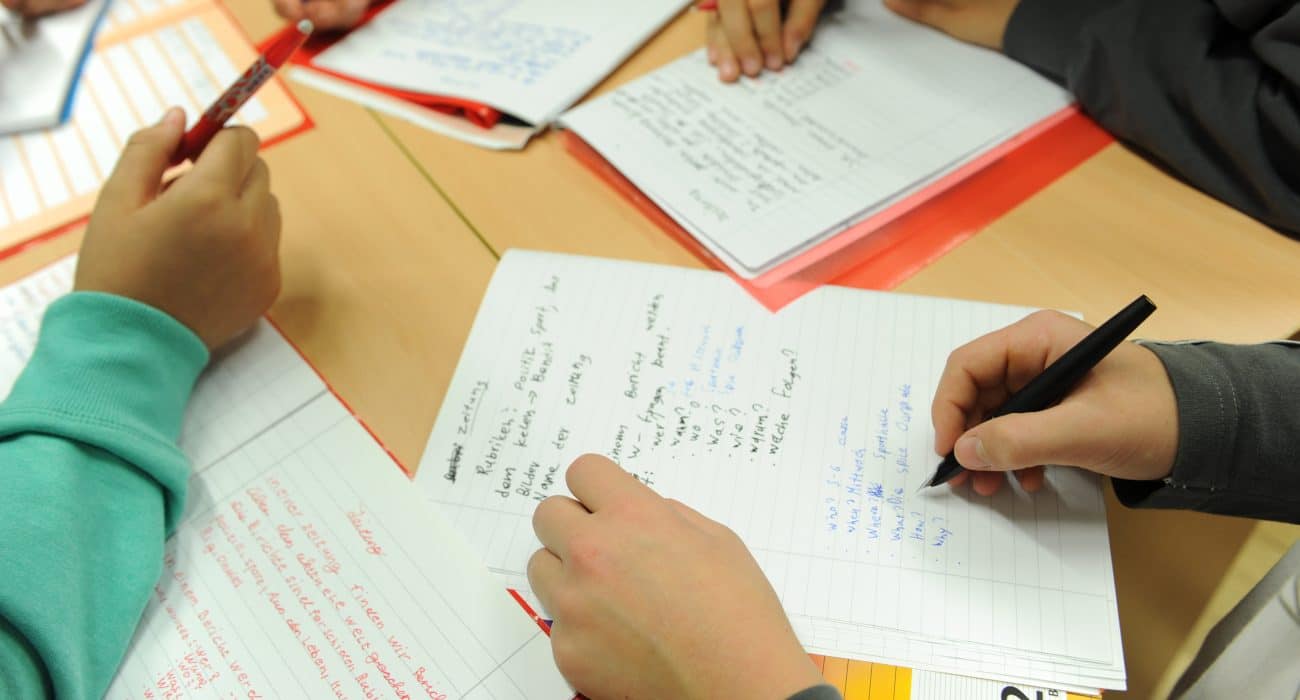Zehn Maßnahmen für gelungene Integration an unseren Schulen
Baden-Württemberg ist eine Einwanderungsgesellschaft – und das ist eine großartige Chance für unser Land. Doch leider versäumen wir es aktuell, auch an unseren Schulen, die vielfältigen Potenziale der Schülerinnen und Schüler weiterzuentwickeln und echte Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten in Klassenstufe 8 (VERA 8) von 2024 zeigen: Im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern mit deutscher Alltagssprache ist in Deutsch, Englisch und Mathematik der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Alltagssprache, deren Leistungen unterhalb des Mindeststandards für den Mittleren Schulabschluss liegen, mehr als doppelt so groß. Und auch der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist in Baden-Württemberg laut dem IQB-Bildungstrend immer noch zu hoch. Doch statt effektive Reformen anzustoßen, verharrt Grün-Schwarz seit Jahren in einer bildungspolitischen Baustelle. Dabei ist unbestritten, dass wir nur mit guter Bildung und fairen Chancen eine erfolgreiche Zukunft für unsere Kinder und für Baden-Württemberg gestalten können. Wir können es uns nicht leisten, Potenzial zu verschenken.
Umso wichtiger ist es deshalb, Integration an unseren Schulen endlich erfolgreich umzusetzen und auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen einzugehen. Viele der Kinder und Jugendlichen mit Flucht- oder Einwanderungshintergrund müssen ihre Bildungslaufbahn im Herkunftsland abbrechen bzw. unterbrechen und sich in ihrem neuen Heimatland auf ein oftmals gänzlich anderes Schulsystem einlassen. Hinzu kommt, dass sie parallel eine völlig neue Sprache erlernen müssen. Es ist deshalb essenziell, dass wir an unseren Schulen mehr Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Fluchthintergrund schaffen. Unsere Schulen haben eine besondere Verantwortung: Sie müssen nicht nur guten Unterricht gestalten, sondern auch Integrationsarbeit leisten. Eine Verantwortung, die auch die Einrichtungen der Frühkindlichen Bildung tragen. Auch hier haben wir bereits zahlreiche Vorschläge eingebracht. Mit diesem Papier möchten wir unseren Fokus nun konkret auf die Schulen legen.
Unsere Forderungen umfassen u.a.:
- Vorverlegung der Schulpflicht.
- Niveaustufentests für zugewanderte Schülerinnen und Schüler.
- Den Aufbau eines ‚Dolmetscherpools BW“.
- Die Stärkung der Elternarbeit.
- Eine Neustrukturierung der Vorbereitungsklassen.
- Den Ausbau von Sprachförderangeboten an weiterführenden Schulen.
- Die Einrichtung von Feriensprachkursen und kostenlosen Angeboten der Hausaufgabenbetreuung
- Mehr Unterstützungspersonal für unsere Schulen.
- Die flächendeckende Einführung des herkunftssprachlichen Unterrichts.
- Die stärkere Verankerung von Integrationsthemen in der Lehrkräftebildung.
- Vorverlegung der Schulpflicht
Es ist wichtig, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche zeitnah in unser Bildungssystem integriert werden. Deshalb werden wir den Beginn der Schulpflicht von sechs auf drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland verkürzen. Dafür streben wir eine Änderung des § 72 des Schulgesetzes an.
- Niveaustufentests für zugewanderte Schülerinnen und Schüler
Wir müssen die Aufgabe der Integration auf alle Schularten verteilen – aktuell sind wir von diesem Anspruch aber immer noch weit entfernt. Daher fordern wir die Einführung von Niveaustufentests in der Herkunftssprache für aus dem Ausland zugewanderte Kinder und Jugendliche und entwickeln hierzu das Analyseverfahren Potenzial und Perspektive (2P) weiter. Neben einem fachlichen Teil wird in dem Test auch der Sprachstand erhoben. Die Teilnahme an dem Test ist verpflichtend. Basierend auf den Testergebnissen sowie nach einem Beratungsgespräch über die Anforderungen der einzelnen Schularten wird eine fundierte Empfehlung für den Besuch einer weiterführenden Schulart ausgesprochen. Die endgültige Wahl der Schulart bleibt den Eltern überlassen.
- Aufbau eines ,Dolmetscherpools BW‘
Für Elterngespräche und ein erfolgreiches Zusammenspiel zwischen Lehrkräften und Eltern ist oftmals der Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern notwendig. Diese können neben der Unterstützung bei der Überwindung sprachlicher Barrieren auch über jeweilige kulturelle Hintergründe informieren und bei Unterschieden vermitteln. Wir fordern daher den Aufbau eines verlässlichen ,Dolmetscherpools BW‘ durch das Land, der alle Sprachen und Regionen in Baden-Württemberg abdeckt. Der Dolmetscherpool muss allen Lehrkräften einfach über eine App zugänglich gemacht werden. Die Dolmetscherinnen und Dolmetscher werden auf Honorarbasis eingesetzt, vom Land finanziert und sind regional an die Landkreise ange-dockt. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie die Landkreise müssen dafür Sorge tragen, dass alle Schulleitungen und Lehrkräfte über das Angebot informiert sind.
- Stärkung der Elternarbeit
Eltern müssen von Beginn an in die Strukturen des baden-württembergischen Bildungssystems eingebunden werden. Deshalb möchten wir die Bildungs- und Erziehungspartnerschaften als Vereinbarung zwischen Eltern und Schulen ausbauen. In der Vereinbarung sollen gegenseitige Erwartungen von Eltern und Schule sowie die jeweiligen Verantwortungsbereiche zur Unterstützung des Bildungsverlaufs von Kindern klar definiert werden. Hierzu müssen in einem ersten Schritt Informationen über das baden-württembergische Bildungssystem und Beratungsangebote für Eltern mehrsprachig zur Verfügung stehen. Um Sprachbarrieren bei Beratungsterminen und Informationsveranstaltungen zu überwinden, soll der ,Dolmetscherpool BW‘ auch für solche Angebote zur Verfügung stehen – denn Elternberatung muss auch in der Herkunftssprache möglich sein.
Auf Nachfrage müssen auch Zeugnisse und verschriftlichte Leistungsrückmeldungen in die Muttersprache der Eltern übersetzt werden. Außerdem sollen alle Schulträger verpflichtet werden, Willkommensordner für alle neu an die Schulen gekommenen Kinder und Jugendlichen bereitzustellen. Diese sollten unter anderem individuelle Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie Kultur- und Sportangebote in der Raumschaft enthalten.
Angebote speziell für Eltern von zugewanderten Kindern werden wir ausbauen. Dazu gehört beispielsweise die flächendeckende Ausweitung des ‚Rucksack-Projekts‘. In diesem Projekt treffen sich Eltern regelmäßig und werden mit verschieden Maßnahmen dabei unterstützt, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Solche Angebote müssen an allen Schulen zur Verfügung stehen. Des Weiteren möchten wir prüfen, inwiefern Sprachkurse für Eltern und speziell für Mütter, am Vormittag in der Schule umgesetzt werden können.
Ein wichtiger Partner für die Umsetzung der Unterstützungsangebote muss die Elternstiftung sein. Diese soll für ihre Arbeit zusätzliche finanzielle Mittel des Landes in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr erhalten.
- Neustrukturierung der Vorbereitungsklassen
Unsere Schulstrukturen dürfen Kinder und Jugendliche nicht aussortieren, sondern müssen sie integrieren. Deshalb sollten Schülerinnen und Schüler nach kanadischem Vorbild so schnell wie möglich am Unterricht in den Regelklassen teilnehmen. Wir schlagen daher vor, die Zeit, in denen Schülerinnen und Schüler ausschließlich am Unterricht in Vorbereitungsklassen teilnehmen, in der Regel auf maximal drei Monate zu begrenzen. Die Verweildauer muss so kurz wie möglich sein – die schnelle Integration in die Regel-klasse ist oberstes Gebot. Daher befürworten wir die Teilnahme am Regelunterricht ab dem ersten Tag.
Schulbegleitungen sollen bei der besseren und schnelleren Integration in die Regelklassen unterstützen.
Dafür müssen sie eine angemessene Bezahlung und langfristige Verträge erhalten. An den Schulen soll eine Fachleitungsstelle „Integration“, besetzt mit einer Lehrkraft, mit einem Deputatsnachlass von einer Stunde eingerichtet werden. Kleinere Schulen können bei Bedarf eine gemeinsame Fachleitungsstelle ein-richten. Schülerinnen und Schüler, die Teil einer Vorbereitungsklasse sind, werden im Ganztag unterrichtet – nachmittags findet überwiegend der Sprachunterricht statt. An diesem nehmen die Schülerinnen und Schüler bis zu einem Jahr teil, je nachdem, wie sich der Förderbedarf darstellt. In jeder Vorbereitungsklasse unterrichten zwei Lehrkräfte, die durch die höhere Personalausstattung auf die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten, die unterschiedlichen Sprachniveaus und Unterstützungsbedarfe eingehen können. Die Vorbereitungsklassen müssen an allen Schularten ausgebaut und perspektivisch an allen Schularten und Schulen eingerichtet werden. Dort, wo es aufgrund der niedrigen Zahl der Schülerinnen und Schüler nicht möglich ist, Klassen an einzelnen Schulen einzurichten, sollen sich Schulen zu Verbünden zusammen-schließen. Die Aufteilung der Vorbereitungsklassen erfolgt in die Klassenstufen fünf bis sieben und acht bis zehn. Neben dem intensiven Fokus auf Spracherwerb sollen auch die Themen Demokratiebildung, digitales Arbeiten und Organisation des Schulalltags auf dem Unterrichtsplan stehen. Die „Kooperative Berufsorientierung für neu Zugewanderte“ (KOOBO-Z) werden wir flächendeckend ausbauen und gesichert finanzieren.
- Ausbau von Sprachförderangeboten an weiterführenden Schulen
Wir führen die verpflichtende Teilnahme an zusätzlichen Sprachförderprogrammen für Schülerinnen und Schüler an allen weiterführenden Schulen ein, die auch in höheren Klassenstufen noch Unterstützungs-bedarf im deutschen Sprachgebrauch haben. Der Umfang beträgt zwei Stunden pro Woche, die Klassengröße beträgt höchstens zwölf Schülerinnen und Schüler. Angemeldet an dem Programm werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften im Einvernehmen mit der Schulleitung. Die Sprachförderprogramme werden von dafür ausgebildeten Sprachförderlehrkräften durchgeführt. Die Ausbildung dieser kann beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen stattfinden. Zur Gewinnung des Personals muss das Land ein Förderprogramm auflegen, das die Weiterbildung von interessierten Personen zur Sprachförderkraft ermöglicht und die Stellen der Sprachförderkräfte entfristen.
- Unterstützungsangebote neben dem Unterricht ausbauen
Schülerinnen und Schüler sollen innerhalb der ersten zwei Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland Anspruch auf die kostenlose Teilnahme an Feriensprachkursen und Hausaufgabenhilfe erhalten. Die Maßnahmen werden durch Landesmittel finanziert.
Des Weiteren werden wir in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 verpflichtenden Unterstützungsunterricht in Mathe und Deutsch einrichten. An diesem müssen alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die in ihren Zeugnissen in diesen Fächern die Note 4 oder schlechter aufweisen. In Klassenstufen, in denen noch keine Noten vergeben werden oder die auf andere Arten der Rückmeldungen setzen, müssen vergleichbare Kriterien herangezogen werden. Ausnahmeregelungen sind durch Konferenzbeschluss möglich. Der verpflichtende Unterstützungsunterricht soll in Form von zwei Stunden wöchentlich stattfinden und ist kostenlos. Die Angebote beginnen zweimal im Jahr nach der Zeugnisausgabe und sind wahrzunehmen, bis sich die Note verbessert hat. Die Nachhilfe wird über die Schule in deren Räumlichkeiten durch geeignetes Personal, beispielsweise Studierende oder pensionierte Lehrkräfte, durchgeführt. Bei Bedarf kann durch Monetarisierung nicht besetzter Lehrkräftestellen auch externes Personal aus Nachhilfeinstituten an die Schulen geholt werden, wenn mit diesen vorab eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde. Der Unterstützungsunterricht muss in Rücksprache mit der Lehrkraft erfolgen, die individuelle Förderbedarfe benennt und während der Zeit der Fördermaßnahme mit der Unterstützungslehrkraft zur Überprüfung des Lernentwicklungsstands in regelmäßigem Kontakt steht. Hierfür ist auch der Ausbau der datengestützten Qualitätsentwicklung wichtig, um individuelle Unterstützungsbedarfe der Kinder und Jugendlichen rechtzeitig zu erkennen. Auch hier werden wir uns am kanadischen Modell „Children at Risk“ orientieren. Zur Akzeptanz des Angebots sollten die Erziehungsberechtigten frühzeitig eingebunden werden, damit die Fördermaßnahme im Einklang mit allen Beteiligten zum Erfolg und Verbesserungen der schulischen Leistungen führt.
- Ausbau von Unterstützungs-Teams (Multiprofessionalität)
Integration kann nur gelingen, wenn ausreichend Ansprechpersonen und Unterstützungsteams an den Schulen zur Verfügung stehen. Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche haben traumatische Erfahrungen gemacht, die wir ernst nehmen und berücksichtigen müssen. Auch an der Schule muss es Möglichkeiten geben, über diese Ängste zu sprechen. Beziehungsarbeit ist hier essenziell. Deshalb müssen wir die Schulsozialarbeit und die Schulpsychologie weiter ausbauen. In einem ersten Schritt ist unser Ziel, an allen Schulen mindestens eine Vollzeitstelle pro 500 Schülerinnen und Schülern zu etablieren. Schulen in herausfordernden Lagen sollen zusätzliche Stellenanteile erhalten.