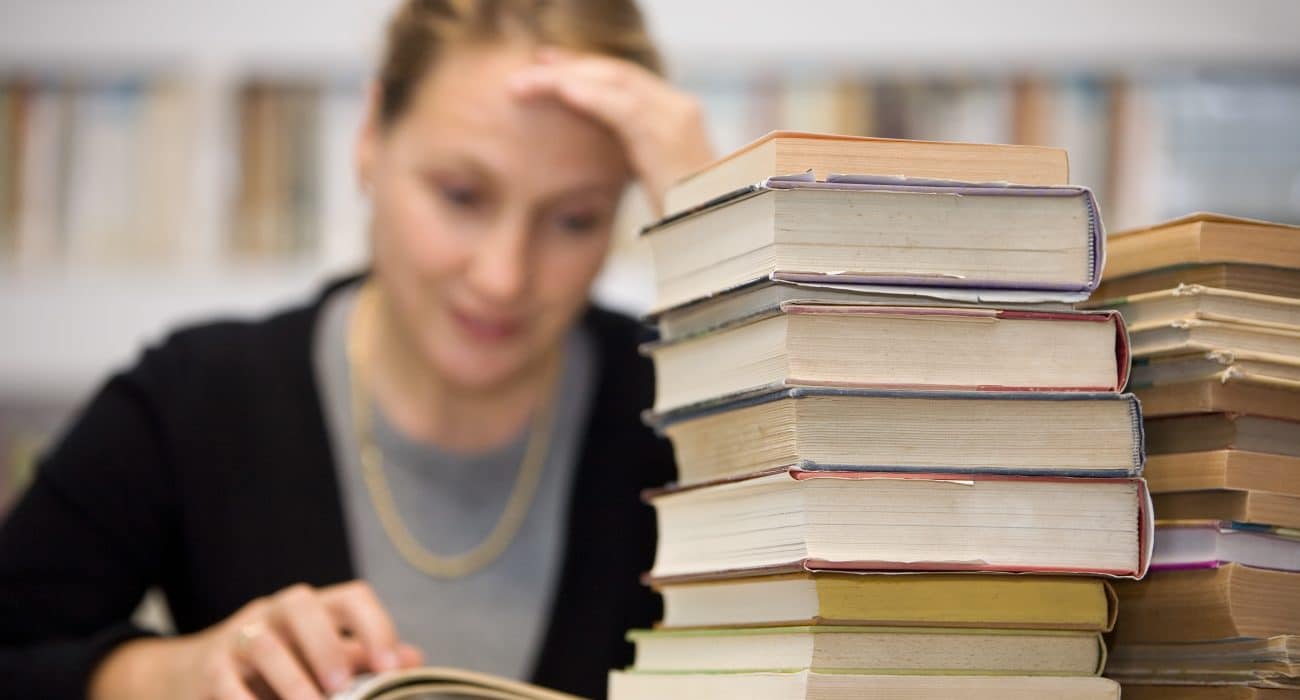1. Die aktuelle Situation der Studierenden
Studierende leiden sehr unter der kriegs- und krisenbedingten Inflation der letzten Jahre. Insbesondere die Miete für WG-Zimmer sind in den großen Universitätsstädten, aber teilweise auch an kleineren Hochschulstandorten stark gestiegen. Und auch die Mietnebenkosten für Energie und Wärme belasten die Studierenden stark. Zugleich spüren Studierende die gestiegenen Kosten für Lebensmittel nicht nur im Supermarkt, sondern auch in den Mensen. Denn die Studierendenwerke mussten Kostensteigerungen zum größten Teil an die Studierenden weitergeben. Deshalb stehen unsere Studierenden unter einem starken finanziellen Druck: Die Armutsgefährdungsquote der Studierenden lag im Jahr 2023 bei ca. 35 % – und das obwohl beispielsweise in Baden-Württemberg über 60 % der Studierenden neben dem Studium einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Studieren in Baden-Württemberg darf keine Frage der finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses der Studierenden sein. Die Situation der Studierenden in Baden-Württemberg muss sich grundlegend bessern. Um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, werden wir das studentische Leben im Land und die Studienqualität an unseren Hochschulen spürbar verbessern. Wir fordern:
- Mehr studentischen Wohnraum schaffen
- Einen Solidarpakt Studierendenwerke
- Psychosoziale Beratung und Sozialberatung der Studierendenwerke sicherstellen
- BAföG verbessern und ausweiten
- Studieren mit Kind muss möglich sein – ausreichend Kita-Plätze an Hochschulen
- Mehr studentische Mobilität ermöglichen
- Ein gebührenfreies Studium für alle
- Mit einer besseren Studienqualität zum erfolgreichen Abschluss
- Chance der reformierten Schuldenbremse nutzen und den Sanierungsstau an den Hochschulen beenden
- Unterstützung für Schüler:innen und Studierende aus nichtakademischen Elternhäusern stärken und die Finanzierung von ArbeiterKind.de verbessern
- Das Studium pausiert nicht – keine Ferienschließungen von Universitätsbibliotheken
- Für Gesundheit, Wohlbefinden und den eigenen Geldbeutel: Hochschulsport ausbauen
2. Unsere Forderungen
2.1 Studentische Leben verbessern
Mehr studentischen Wohnraum schaffen
Es braucht in Baden-Württemberg mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Insbesondere die Kosten für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft sind in den letzten Jahren landesweit stark gestiegen. Im Wintersemester 2024/25 Jahr 2023 zahlten Studierende in Stuttgart im Schnitt monatlich 560 Euro Miete für ein WG-Zimmer. Freiburg liegt mit 520 Euro nur knapp hinter Stuttgart. In Heidelberg und Ludwigsburg sind es 500 bzw. 497 Euro pro WG-Zimmer. Die größte Steigerung seit 2022 hat Tübingen zu verzeichnen: Hier zahlen Studierende gut 10 % mehr für ein WG-Zimmer, im Schnitt 460 Euro. Führt man sich vor Augen, dass Studierende in Baden-Württemberg im Jahr 2021 im Durschnitt 1.000 Euro monatlich zur Verfügung hatten, zeigt sich deutlich, wie wenig den Studierenden nach Abzug der Mietkosten für den Lebensunterhalt bleibt.
Günstiger wohnen können Studierende nur in einem Wohnheimzimmer der Studierendenwerke in Baden-Württemberg, denn die Preise für ein Wohnheimzimmer orientieren sich am Wohngeldanteil im aktuellen BAföG-Höchstsatz von 380 Euro (ab dem Wintersemester 2026/27 wird der Wohngeldanteil auf 440 Euro erhöht). Derzeit haben jedoch nur ca. 10 % der Studierenden in Baden-Württemberg einen Wohnheimplatz. Mit „Junges Wohnen“ hat die letzte Bundesregierung ein Bauprogramm geschaffen, das gezielt Studierende und Auszubildende in den Blick nimmt. Die neue Bundesregierung wird das Programm „Junges Wohnen“ fortführen und die Fördersumme verdoppeln. Hier gilt wie auch bei der allgemeinen Wohnraumförderung: Für jeden Euro des Bundes muss das Land mindestens einen Euro aus Landesmitteln zuschießen. Eine Umschichtung der Mittel für „Junges Wohnen“ in andere Fördertöpfe lehnen wir ab. Zudem müssen die Studierendenwerke in ihren Bauvorhaben adäquat unterstützt werden und neue Wohnheime schnell genehmigt werden. Unser Ziel ist es, bis 2036 mindestens 20 % der Studierenden Wohnheimplätze zur Verfügung zu stellen. Das wird nicht nur den Studierenden und Auszubildenden zugutekommen. Wenn mehr Studierende in Wohnheimen der Studierendenwerke wohnen können, dann entlastet das den Wohnungsmarkt für alle Mieter:innen.
Solidarpakt Studierendenwerke: die Finanzhilfe der Studierendenwerke erhöhen und dynamisieren
Auch die Preise für Verpflegung in den Mensen und Cafeterien der Studierendenwerke sind stark gestiegen. Der Grund für diese Kostensteigerungen liegt in der unzureichenden Finanzhilfe des Landes, die trotz Inflation seit 2020 nicht nennenswert gestiegen ist. Auch 1,2 Mio. Euro mehr jährlich ab 2026 entlasten die Studierenden nicht – vielmehr finanziert das Land diese Erhöhung der Finanzhilfe für die Studierendenwerke direkt aus den Taschen der Studierenden, nämlich über eine Erhöhung des studentischen Verwaltungskostenbeitrags von 70 auf 80 Euro pro Semester.
Die Studierendenwerke stehen bereits seit Jahren unter einem großen finanziellen Druck und haben sich deshalb neu aufgestellt, ihre Strukturen angepasst und so Mittel eingespart, kurz: Die Studierendenwerke haben ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt muss das Land seinen Teil zu einer ausreichenden finanziellen Ausstattung der Studierendenwerke beitragen. Wir werden einen Solidarpakt Studierendenwerke einrichten, in dem die Finanzhilfe für die Studierendenwerke dynamisiert und zudem einmalig um einen Inflationsausgleich erhöht wird. So stellen wir sicher, dass die Studierendenwerke ihre Aufgabe, Studierende sozial, wirtschaftlich und gesundheitlich zu unterstützen und zu fördern, auch erfüllen können.
Psychosoziale Beratung und Sozialberatung der Studierendenwerke sicherstellen
Im Jahr 2021 waren über 50 % der Studierenden oft großem Stress ausgesetzt und rund 42 % fühlten sich aufgrund der Belastungen im Studium häufig ausgelaugt. Zudem sind knapp 24 % der Studierenden gesundheitlich beeinträchtigt, davon leiden 62,3 % an psychischen Belastungen. Die Studierendenwerke unterstützen Studierende bei psychischen und persönlichen Krisen. In den offenen Sprechstunden der Psychosozialen Beratungsstellen finden die Betroffenen erste Hilfen und wenn nötig Unterstützung bei der Suche nach einem passenden Therapieplatz. Die Psychosozialen Beratungsstellen der Studierendenwerke müssen deshalb auch in Zukunft gut finanziert sein. Für die psychotherapeutische Grundversorgung aller Menschen in Baden-Württemberg braucht es zudem ausreichend Therapieplätze. Wir werden sicherstellen, dass jede und jeder, die oder der therapeutische Hilfe benötigt, diese Hilfe auch bekommen kann.
Mit dem Beginn des Studiums verlassen viele junge Menschen das Elternhaus und ziehen meist in ein WG-Zimmer oder ein Wohnheimzimmer. Dieser Übergang in ein selbstständiges Leben kann sehr herausfordern sein. Die Studierenden sind nun in vielen Dingen zum ersten Mal auf sich allein gestellt, beispielsweise bei Fragen der Studienfinanzierung. Bei Problemen können sich die Studierenden an die Sozialberatungsstellen der Studierendenwerke wenden. Auch dieser Service der Studierendenwerke muss ausreichend finanziert werden. Zudem fördern wir die Vernetzung der Sozialberatungsstellen mit anderen Unterstützungsangeboten wie der Schuldnerberatung und unterstützen den weiteren Ausbau der Jugendschuldnerberatung, die sich auch an die Studierenden im Land richtet.
BAföG verbessern und ausweiten
Im Jahr 2023 erhielten bundesweit 12,5 % der Studierende BAföG. In Baden-Württemberg fällt die Förderquote noch geringer aus, hier erhielten nur 10,7 % der Studierenden BAföG. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die geplante große Novelle des BAföG im Bund: Die Wohnkostenpauschale wird zum Wintersemester 2026/27 auf 440 Euro erhöht und regelmäßig überprüft. Die Freibeträge der Studierenden und ihrer Eltern werden dynamisiert, sodass in Zukunft mehr Studierende BAföG beziehen werden. Außerdem wird der Grundbedarfssatz dauerhaft an das Grundsicherungsniveau angepasst – gleichzeitig bleibt die Darlehensdeckelung unverändert. Um BAföG attraktiver zu gestalten, wird die Beantragung vereinfacht, digitalisiert und so weiter beschleunigt.
Die Prüfung der Anträge ist Aufgabe der Studierendenwerke in Baden-Württemberg. Die Umstellung auf vollständige digitale Bearbeitung der Anträge muss zeitnah umgesetzt werden. Die Studierendenwerke benötigen für die Bearbeitung einen kostendeckenden Zuschuss. Sie müssen so finanziert werden, dass zusätzliche Kosten nicht auf die Studierenden abgewälzt werden. Außerdem ist es nicht hinnehmbar, dass Studierende drei bis sechs Monate auf die Bewilligung der Förderung warten müssen und im schlechtesten Fall in dieser Zeit ihre Miete nicht bezahlen können. Zwar können die Studierenden sechs Wochen nach dem BAföG-Antrag einen Vorschuss bekommen. Doch auch für diesen Vorschuss müssen die Studierenden einen erneuten Antrag stellen, der wiederum in den Studierendenwerken bearbeitet werden muss. Deshalb führen wir eine Fiktionsbescheinigung ein: Wenn Studierende nach sechs Wochen noch keinen Bescheid bekommen haben, bekommen sie automatisch 80 % des ihnen voraussichtlich zustehenden Bedarfs ausgezahlt.
Studieren mit Kind muss möglich sein – ausreichend Kita-Plätze an Hochschulen
Rund 8 % der Studierenden haben Kinder. Die meisten dieser Kinder (ca. 63 % im Jahr 2021) sind noch nicht im schulpflichtigen Alter. Bei der Betreuung ihrer Kinder werden die studierenden Eltern von den Studierendenwerken im Land unterstützt. Beispielsweise verfügt das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim über 94 eigene Kita-Plätze und 40 Belegplätze bei anderen Kita-Trägern für Kinder studierender Eltern an drei Standorten mit rund 41.000 Studierenden (Tübingen, Reutlingen und Hohenheim). Dieses Angebot der Studierendenwerke muss aufrechterhalten und bei Bedarf ausgebaut werden. Derzeit sind die Kosten für studierende Eltern je nach Hochschulstandort sehr hoch. In Kitas des Studierendenwerks Heidelberg zahlen studierende Eltern zwischen 400 und 550 Euro monatlich für die Betreuung ihrer Kinder. Eigene Kinder dürfen jedoch kein Hindernis für studierende Eltern sein, ihr Studium erfolgreich abzuschließen – deshalb müssen ausreichend Kita-Plätze an allen Hochschulstandorten im Land angeboten werden. Durch eine bessere Finanzierung können die Studierendenwerke mehr Kita-Plätze anbieten und zudem die Beiträge für studierende Eltern senken. Das fördert auch die Chancengleichheit: Studentinnen sind deutlich häufiger alleinerziehend als Studenten (16,8 vs. 3,3 %).
Mehr studentische Mobilität ermöglichen
Die Vereinbarungen zu den Semestertickets an den einzelnen Hochschulstandorten gleichen einem Flickenteppich. Bisher gibt es trotz Einführung des Deutschlandtickets kein einheitliches ÖPNV-Ticket im Land, das es allen Studierenden ermöglicht, deutschlandweit den Nahverkehr zu günstigen Konditionen zu nutzen. Die Lösung ist das JugendTicketBW, das wir weiter für Studierende öffnen werden. Aktuell kostet das JugendTicketBW im Jahr 473 Euro (monatlich rund 39 Euro). Da der Preis für das Deutschlandticket ab 2029 schrittweise erhöht wird, wird auch der daran gekoppelte Preis für das JugendticketBW weiter steigen. Wir werden diese Erhöhung nicht allein die Jugendlichen, Auszubildenden und Studierenden bezahlen lassen.
Derzeit können Studierende das JugendticketBW nur bis zum 27. Geburtstag nutzen. Allerdings sind deutschlandweit gut 20 % der Studierenden über 27 Jahre alt. Wir werden es über Ausnahmeregelungen auch den älteren Studierenden ermöglichen, das JugendTicketBW über den 27. Geburtstag hinaus zu beziehen. Bei der Altersgrenze für Studierende orientieren wir uns an der Altersgrenze für den Bezug von BAföG: Wer das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und an einer Hochschule in Baden-Württemberg eingeschrieben ist, kann das JugendTicketBW nutzen.
Ein gebührenfreies Studium für alle
Die Studierendenzahlen in Baden-Württemberg sind seit 2019 stetig gesunken; nur im Wintersemester 2024/25 konnte ein sehr geringer Zuwachs von 400 Studierenden verzeichnet werden. Aufgrund der Studiengebühren von 3.000 Euro pro Jahr konnten die Hochschulen in Baden-Württemberg den Anteil an internationalen Studierenden seit 2017 nicht steigern – noch immer liegt dieser Anteil bei nur rund 10 % (zum Vergleich: an bayrischen Hochschulen machen internationale Studierende einen Anteil von ca. 20 % aus). Dabei studieren internationale Studierende überproportional häufig ein Fach im MINT-Bereich oder in den Ingenieurswissenschaften. Sie sind ein wichtiger Teil der Lösung, um dem Fachkräftemangel insbesondere in technischen Berufen zu begegnen. Zudem sind internationale Studierende ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor: Bei einer guten Bleibequote erwirtschaften sie in den zehn Jahren nach Abschluss ihres Studiums für den deutschen Staat ca. 15,5 Mrd. Euro und damit weit mehr, als der Staat in die Studierenden während des Studiums investiert hat. Die Studiengebühren in Baden-Württemberg vergraulen internationale Studierende jedoch und müssen so rasch wie möglich abgeschafft werden! In diesem Zuge werden wir auch die Studiengebühren für das Zweitstudium abschaffen. Solche Gebühren stehen der Fort- und Weiterbildung im Weg und verschärften so den Fachkräftemangel weiter.
2.2 Studienbedingungen verbessern – Abbrüche verhindern
Mit einer besseren Studienqualität zum erfolgreichen Abschluss
Neben einer ausreichenden Finanzierung des Studiums und bezahlbarem Wohnraum spielt auch die Qualität der Studiengänge in Baden-Württemberg eine bedeutende Rolle für den erfolgreichen Abschluss des Studiums. Die Hochschulen im Land müssen gute und für die Anzahl der Studierenden ausreichende Vorlesungen und Seminare anbieten können. Für den Studienerfolg sind zudem Tutorien, Übungen und Laborpraktika auschlaggebend. Insbesondere in den MINT-Fächern können Prüfungen ohne den Besuch eines vorlesungsbegleitenden Tutoriums oder einer Übung kaum erfolgreich bestanden werden. An Tutorien und Übungen darf deshalb nicht gespart werden. Eine ausreichende Finanzierung der Hochschulen sorgt dafür, dass mehr Tutorien und Übungen angeboten werden können, die durchschnittliche Teilnehmendenzahl an diesen Tutorien und Übungen sinkt und die Studierenden besser die in den Vorlesungen und Seminaren vermittelten Inhalte erlernen und vertiefen können. So lässt sich die Qualität der Studiengänge steigern und auch die Abbrecherquote insbesondere in den MINT-Fächern senken. Das ist nicht nur im Interesse der Studierenden, sondern auch im Interesse der Unternehmen im Land, die auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind.
Sanierungsstau an den Hochschulen – Chance der reformierten Schuldenbremse nutzen
Marode Seminarräume, undichte Dächer, Bibliotheken, die kaum genutzt werden können, Labore, die geschlossen werden müssen, weil Arbeiten und Lernen dort aufgrund des baulichen Zustands gefährlich werden kann – all das ist Ausdruck des immensen Sanierungsstaus an den Hochschulen in Deutschland und beeinträchtigt die Studienqualität bundesweit. Mindestens 74 Milliarden Euro bräuchte es, um die seit Jahrzehnten vernachlässigten Hochschulen zu sanieren. Laut Berechnungen der Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg hat sich allein an den neun Universitäten im Land ein Sanierungsstau von sechs bis acht Milliarden Euro angesammelt. Mit der Reform der Schuldenbremse und dem Sondervermögen für Infrastruktur startet die neue Bundesregierung eine Schnellbauinitiative von Bund und Ländern zur Modernisierung von Hochschulen und Universitätskliniken, die neben Lehr- und Forschungsbauten auch die Mensen und Cafeterien umfasst. Damit hat nun auch Baden-Württemberg die Chance, den Sanierungsstau an den Hochschulen konstruktiv anzugehen. Dafür ist es unerlässlich, neben einer gut durchdachten Planung, wie die zu erwartende 1 Mrd. Euro pro Jahr möglichst effizient für Infrastrukturprojekte im Land eingesetzt werden können, Planungs- und Bauzeiten durch Bürokratieabbau zu verkürzen. Dafür müssen die Regelungen für Bauprojekte wie beispielsweise die Flächenbemessungsgrenze durch das Land überarbeitet werden. Und auch finanziell muss das Land aktiv werden: Die Reform der Schuldenbremse gibt den Ländern mehr Spielraum – eine Chance, die wir unbedingt nutzen müssen! Nur so kann Baden-Württemberg weiterhin Spitzenforschungsland bleiben und für eine Verbesserung der Studienqualität sorgen.
Unterstützung für Schüler:innen und Studierende aus nichtakademischen Elternhäusern stärken
Studierende aus Akademikerfamilien sind überproportional an den Hochschulen vertreten: Obwohl nur 28 % der jungen Menschen in Deutschland aus einem akademisch gebildeten Elternhaus kommen, sind 55 % der Studienanfänger:innen „Akademikerkinder“. Nur 45 % der Studienanfänger:innen stammen aus einem nichtakademischen Elternhaus (sogenannte First-Generation-Studierende oder Studierende der ersten Generation), obwohl ihr Anteil an der altersgleichen Bevölkerung bei 72 % liegt. Diese Zahlen zeigen: Der Bildungstrichter, der den leichteren Zugang zu hochschulischer Bildung von Kindern aus akademisch gebildeten Familien mit dem erschwerten Zugang von First-Generation-Studierenden vergleicht, ist nicht überwunden. Das Problem ist tief in unserem Bildungssystem verankert, denn die Ungleichheit beginnt bereits in der Kita. Doch auch an Schulen und Hochschulen kann gegengesteuert werden. Durch eine zukunftsgerichtete Bildungspolitik ermöglichen wir mehr Wege zum Abitur und verbessern die Unterstützung und Beratung für studieninteressierte Schüler:innen aus nichtakademischen Elternhäusern. So erhöhen wir die Studierwahrscheinlichkeiten von First-Generation-Schüler:innen.
Finanzierung von ArbeiterKind.de verbessern
ArbeiterKind.de ist eine studentische Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, studieninteressierte Schüler:innen und Studierende der ersten Generation bei ihrer Studienwahl und während ihres Studiums zu unterstützen. Viele der ehrenamtlich tätigen Berater:innen stammen selbst aus nichtakademischen Familien und wissen um die Probleme der First-Generation-Studierenden. Auf diese Weise bietet ArbeiterKind.de den Studierenden eine Plattform, auf der sie sich austauschen und vernetzen können. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, muss ArbeiterKind.de dringend besser finanziert werden. Derzeit ist die Finanzierung und insbesondere der Anteil des Landes daran (2025 und 2026 jeweils 75.000 Euro) nicht sicher geregelt. ArbeiterKind.de ist in der Finanzierung vom Wohlwollen der Regierungsfraktionen abhängig. Wir wollen das endlich ändern und die beiden hauptamtlichen Stellen von ArbeiterKind.de in Baden-Württemberg über Mittel des Wissenschaftsministeriums voll finanzieren.
Das Studium pausiert nicht – keine Ferienschließungen von Universitätsbibliotheken
Insbesondere die Universitäten leiden unter den hohen Energiekosten, da das Land hierfür nur eine Pauschale bereitstellt und darüberhinausgehende Kosten durch Einsparungen an den Universitäten finanziert werden müssen. Das hat zur Folge, dass Hochschulen beispielsweise über die Weihnachtsferien schließen und in dieser Zeit ihre Räumlichkeiten nicht heizen. So begrüßenswert das in Hinblick auf die Kosten und auch auf CO2-Eisparungen ist, dürfen davon nicht die Universitätsbibliotheken betroffen sein. Weder das Studium noch die Forschung pausieren in dieser Zeit und viele Studierende sind darauf angewiesen, auch in den Ferien weiter an Haus- oder Abschlussarbeiten zu schreiben oder sich auf anstehende Prüfungen vorzubereiten. Wir fordern: Universitätsbibliotheken dürfen in der Zeit der Weihnachtsferien nicht geschlossen werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Universitäten in der Lage sind, die Bibliotheken zu öffnen – auch wenn das bedeutet, dass der Zuschuss aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt zu den Energiekosten erhöht werden muss.
Für Gesundheit, Wohlbefinden und den eigenen Geldbeutel: Hochschulsport ausbauen
Unsere Hochschulen, insbesondere die großen Universitäten, verfügen über ein vielfältiges, für Studierende meist kostenfreies Hochschulsportangebot. Studierende können Fitnesskurse besuchen, neue Sportarten niedrigschwellig ausprobieren und häufig auch Fitnessgeräte an der Hochschule nutzen. Sport und Bewegung sind essentiell für Gesundheit und Wohlbefinden und es ist gut, dass Studierende kein Geld für Fitnessstudios ausgeben müssen, um sich fit zu halten. Deshalb muss das Angebot des Hochschulsports an allen Hochschulstandorten in Baden-Württemberg – auch an den kleineren Standorten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften – für Studierende kostenfrei bleiben und darf nicht als Sparmaßnahme ausgedünnt werden. Wir werden deshalb die Regelungen zur Unterbringungspflicht von Hochschulsport für Vermögen und Bau anpassen, sodass auch in Wohnheimen Fitnessräume entstehen können.
Ansprechpartner